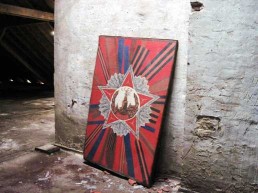Guter Kaufpreis trotz Unsicherheit beim Unternehmensverkauf
Einer der wesentlichen Punkte beim Verkauf von Unternehmen ist der Kaufpreis.
Diesen festzulegen ist aus vielen Gründen nicht ganz einfach. Dies haben wir in unserem Buch zum Unternehmenskauf ausführlich und zum selber Rechnen beschrieben.
Einer der Gründe ist, dass zwischen Verkäufer und Käufer ein Informationsdefizit besteht: der Verkäufer kann die künftige Entwicklung besser einschätzen als der Käufer. Für die von ihm vermuteten Risiken wird der Käufer in der Regel aber einen Abschlag vornehmen wollen.
Die Standardverfahren zur Ermittlung des Unternehmenswertes knüpfen an den künftig zu erzielenden Ertrag an. In der aktuellen Situation der COVID19-Pandemie ist die künftige Entwicklung des Unternehmens und damit dessen Wert aber schwieriger einzuschätzen als sonst.
Deshalb gewinnen in M&A-Projekten derzeit Earn-Out-Klauseln an Bedeutung. Dabei wird ein variabler Teil des Kaufpreises vom Eintritt bestimmter Bedingungen abhängig gemacht. Solche Klauseln sind eine gute Möglichkeit unterschiedliche Ansichten über den „richtigen“ zum Kaufpreis zwischen Käufer und Verkäufer zu überbrücken.Read more
Wir verkaufen Unternehmen - wie COVID19 unsere Arbeit verändert
Machen wir uns nichts vor: Dienstleister wie wir sind in einer relativ komfortablen Situation. Die Akten sind ohnehin alle digitalisiert und das meiste lässt sich vom Homeoffice aus per eMail, elektronischem Datenraum, Telefon und Videokonferenz erledigen. Viele andere sind deutlich schlechter dran.Read more
Was Sie jetzt tun müssen - eine Maßnahmenliste in Stichpunkten
Im Moment geht es für die meisten Betriebe darum, irgendwie den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Wenn die COVID19-Pandemie irgendwann hoffentlich überwunden sein wird, steht die Beseitigung der finanziellen Folgen ganz oben auf der Liste
Aufhänger ist dabei, dass – nach der aktuellen Rechtslage – bis zum 01.10.2020 oder nach Verlängerung bis zum 01.04.2021 eine nun eingetretene Zahlungsunfähigkeit beseitigt werden muss. Fangen Sie deswegen am besten jetzt schon an, eine Inventur bei der Liquidität zu machen.
Was ich in den letzten 20 Jahren bei der Sanierung von Unternehmen gelernt haben, haben wir nachfolgend in einer kurzen Maßnahmenliste in Stichpunkten für Sie zusammengefasst.Read more
Verlust von Verlustvorträgen bei Betriebsverpachtung (BFH)
Von „stillen Reserven“ spricht man, wenn in einem Betriebsvermögen Gegenstände mit einem niedrigeren Wert in den Büchern stehen, als dem so genannten Teilwert. Dieser Teilwert in ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG definiert) als der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde, wobei davon auszugehen ist, dass der Erwerber den Betrieb fortführt.
Diese stillen Reserven entstehen, weil Wirtschaftsgüter wie Maschinen oder Fahrzeuge abgeschrieben werden oder bei Grundstücken und Gebäuden Wertsteigerungen aufgetreten sind.
Wenn beispielsweise ein Firmenwagen zum Preis von 100.000,00 € angeschafft wird, kann der Kaufpreis über einen Zeitraum von 6 Jahren abgeschrieben werden - also rd. 16.667,00 € pro Jahr. Dieser Betrag wird als Aufwand verbucht und spiegelbildlich sinkt der Wert des Fahrzeugs. Nach sechs Jahren ist der Buchwert des Fahrzeugs auf einen Erinnerungswert von 1,00 € gesunken.
Tatsächlich hat das Fahrzeug aber natürlich nach wie vor einen Wert. Wenn Sie es beispielsweise für 20.000,00 € verkaufen könnten, ist das der Betrag der stillen Reserven.
Wenn ein Unternehmer sein Unternehmen nicht weiter betreiben will, kann er sein Gewerbe aufgeben oder verkaufen (wenn Sie über einen Unternehmensverkauf nachdenken, rufen Sie uns unbedingt an!). In diesen beiden Fällen kommt es zur Aufdeckung der stiller Reserven. Dieser Aufgabe- oder Veräußerungsgewinn muss versteuert werden.
Eine weitere Variante ist die Betriebsverpachtung: dabei lässt der Unternehmer den Betrieb ruhen und vermietet diesen mit all seinen Betriebsgrundlagen. Dabei erzielt der ehemalige Unternehmer weiterhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb, stille Reserven werden nicht aufgedeckt, ein Aufgabe- oder Veräußerungsgewinn entsteht nicht und muss deshalb auch nicht versteuert werden.
Zu einem interessanten Teilproblem bei dieser Variante hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil vom 30.10.2019 geäußert (Aktenzeichen IV R 59/16).Read more
Unternehmensverkauf: Fachgroßhandel für Batterien und Akkus
Allgemein
Das Unternehmen benötigt zum Erhalt und zur Fortsetzung seiner Geschäftstätigkeit Kapital. Es ist geplant, kurzfristig einen geeigneten Investor zu finden, der sich entweder mit entsprechendem Kapital beteiligt oder das Unternehmen komplett übernimmt.
Unternehmensgegenstand und Historie
Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1977 vom Vater des heutigen Inhabers/Geschäftsführers, der das Unternehmen seinerzeit noch sehr unkonventionelle aus dem eigenen VW-Bulli heraus betrieb. Entsprechendes Wachstum sorgte allerdings bereits 1987 dafür, dass die erste eigene Immobilie bezogen werden konnte. Im Jahr 2000 wurde die heutige Gesellschaft gegründet. Versierte Arbeitnehmer und die Kompetenz des Unternehmens sorgten dafür, dass sich die positive Entwicklung fortsetze. Im Jahr 2000 wurde am heutigen Standort eine moderne Industrieimmobilie bezogen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und genießt aufgrund seines außergewöhnlichen Leistungsspektrums einen hervorragenden Ruf.
Leistungsspektrum
Anspruch des Unternehmens war es schon immer, für seine Kunden nicht nur Händler sondern wichtiger Partner zu sein. Besonderes Augenmerk muss deshalb auch den Eigen- und Exklusiv-Marken gelten, bei denen die Kunden das höchste Maß an Beratungsqualität und Flexibilität für kundenspezifische Anpassungen am Point-of-Sale nutzen. Insgesamt war das Unternehmen schon immer sehr fachhandelslastig. Kunden waren von Beginn an der seinerzeit noch sehr starke Fotofahhandel, sowie der Elektro- bzw. Elektronikfachhandel. Dadurch entwickelte das Unternehmen eine Distributions- und Fachkompetenz, die dazu führte, dass das Unternehmen andere Großhändler belieferte, die u.a. im Bereich Elektro und Sanitär ihren Schwerpunkt hatten. Es ist geplant, das Angebot zu straffen und sich künftig als Fachgroßhandel für Industrie-, Handels- und Gewerbekunden zu positionieren.
Produkte
Das Produktangebot des Unternehmens umfasst Akkus, Batterien, Ladegräte/Netzteile, Lampen/Leuchten, Taschenlampen und Werkzeugakkus für die Industrie bzw. für Industrieanwendungen. Das Unternehmen führt ausschließlich sogenannte „große Marken“ wie EXIDE, CAT, Panasonic, VARTA, Duracell, Energizer sowie eine bekannte Eigenmarke, um nur einige zu nennen.
Personal
Neben dem Geschäftsführer sind insgesamt 31 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.
Kunden
Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Groß- und Einzelhandel und Behörden, wie z.B. die Polizei Hamburg (Taschenlampen).
Unternehmensstandort
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen, im Regierungsbezirk Münster.
Gerne stellen wir Ihnen ein anonymisiertes Exposé-Fachgroßhandel-Batterien-und-Akkus.pdf zur Verfügung. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Unternehmensverkauf: Unternehmen für die Entwicklung und den Betrieb erprobter Trendfood-Konzepte
Unternehmenshistorie und Gegenstand
Gegenstand des 2010 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung und der Betrieb von skalierbaren gastronomischen Trendfood-Konzepten. Alle Konzepte setzen auf den aktuellen Food-Trend: Eat fresh – eat happy! Sie setzen auf gesunde und vitaminreiche Lebensmittel, die individuell nach den Wünschen und Vorlieben des Kunden aus tagfrischen Zutaten zubereitet werden. Sämtliche Konzepte erzielen deutlich positive Deckungsbeiträge, sind skalierbar und zum Franchise geeignet.
Preview Unternehmensverkauf: Cooles Unternehmen im Bereich Trend-Food-Konzepte!
Der Auftrag ist erteilt. Wir arbeiten unter Hochdruck.
In Kürze veröffentlichen wir das Exposé zu einem Neuauftrag: Wir suchen einen geeigneten Nachfolger für ein Unternehmen, das verschiedene Trend-Food-Konzepte entwickelt, in den Markt gebracht hat und erfolgreich betreibt. Die Konzepte haben sich bewährt und können so übernommen und fortgeführt werden - skalierbar und zum Franchise geeignet.
Derzeit arbeiten wir noch an der Fertigstellung der Unternehmensbewertung.
Demnächst mehr!
Herausforderung Unternehmensnachfolge (Vortrag)
IHK-Pressebericht zum Vortrag von Bärbel Schnee-Gronauer und Klaus Neesen am 13.06.2019:
Rund 60 Teilnehmer informierten sich im Rahmen der IHK-Veranstaltungsreihe „Stabwechsel – Nachfolge erfolgreich gestalten“ darüber, wie sich Unternehmer oder Existenzgründer auf eine Unternehmensnachfolge vorbereiten können und wo im Einzelfall Fallstricke lauern. Zu der Veranstaltung hatte die IHK gemeinsam mit der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim in den NINO-Hochbau nach Nordhorn eingeladen.
Verhindert Datenschutz die Sanierung von Unternehmen?
Just gestern hat Pluta, eine der führenden Insolvenzverwalterkanzleien, ist einer Pressemeldung mitgeteilt, dass ein Verkauf der H&H Touristik-Gruppe nicht möglich ist und der Betrieb eingestellt werden muss.
Haftung des Kommanditisten und AGB und Anteilskauf (BGH)
Die Haftung der Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft bildet den Rahmen einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs bei der es um die Haftungsverteilung beim Kauf von Kommanditanteilen ging (BGH, Urteil vom 26. März 2019 - II ZR 413/18).
Hintergrund und systematische Einordnung
In der Kommanditgesellschaft gibt es zwei Arten von Gesellschaftern: Kommanditisten (auch "Teilhafter" genannt) und Komplementäre (auch "Vollhafter" genannt).
Der Komplementär führt die Geschäfte der Gesellschaft, haftet dafür aber unbeschränkt; der Kommanditist haftet nur mit seiner Einlage, ist in der Regel aber auch von der Geschäftsführung ausgeschlossen.
Die Haftungsbegrenzung zugunsten des Kommanditisten greift allerdings nur, soweit dieser seine Einlage tatsächlich geleistet hat (§ 171 Abs. 1 2. HS. HGB).
Hat er dies nicht getan, haftet er für Schulden der Gesellschaft bis zur Höhe seiner Einlage (§ 171 Abs. 1 2. HS. HGB). Das gleiche gilt, wenn der Kommanditist seine Haftungseinlage zwar formal erbracht hat, diese dann aber an ihn zurückgezahlt wurde (§ 172 Abs. 4 HGB).
Dabei müssen die Gläubiger der Gesellschaft nicht zuerst die Gesellschaft auf Leistung in Anspruch nehmen, sondern können sich direkt an den Kommanditisten wenden.
Wenn der Kommanditist daraufhin an die Gläubiger zahlt, wird er insoweit auch gegenüber den anderen Gläubigern frei.
Auch wenn diese Haftungsbefreiung nicht direkt im Verhältnis zwischen Gesellschafter und Gesellschaft bzw. deren Insolvenzverwalter gilt, muss der Gesellschafter nicht doppelt zahlen. Er hat nämlich in Höhe der Forderung einen Ersatzanspruch gegen die Gesellschaft (§ 110 HGB) - diesen kann er gegen die Forderung der Gesellschaft bzw. deren Insolvenzverwalter aufrechnen (BGH, Urteil v. 25.07.2017, II ZR 122/16).
Sachverhalt
Eine Gesellschaft, die gewerblich mit Geschäftsanteilen auf dem Zweitmarkt handelt, erwarb im Jahr 2008 vom späteren Beklagten dessen Kommanditanteil an der MS "B. " Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. Reederei KG im Nennwert von 900.000 € für einen Kaufpreis von rd. 530.000 €.
Der Kaufvertrag wurde am 25./26.8.2008 geschlossen, als "Stichtag für die wirtschaftliche Wirkung des Verkaufs und der Übertragung" wurde der 1.8.2008 vereinbart.
Bis zu dem vereinbarten Stichtag hatte der Beklagte aus der Beteiligung Ausschüttungen i.H.v. insgesamt 288.000 € erhalten.
Am 17.3.2009 wurde das Ausscheiden des Beklagten aus der Kommanditgesellschaft in das Handelsregister eingetragen.
Am 19.4.2014 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Kommanditgesellschaft eröffnet. Daraufhin forderte der Insolvenzverwalter die Klägerin unter Berufung auf § 172 Abs. 4, § 171 Abs. 1 HGB zur Rückzahlung der Ausschüttungen auf die von dem Beklagten erworbene Beteiligung auf.
Die Käuferin nahm daraufhin den Beklagten auf Freistellung durch Zahlung des Betrages von 288.000 € an den Insolvenzverwalter der Kommanditgesellschaft, hilfsweise auf Befreiung von der Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter in dieser Höhe in Anspruch.
Dabei stützt sich die Klägerin auf ihre Allgemeinen Vertragsbedingungen in denen es heißt:
“Für Umstände, die die Kommanditistenhaftung vor dem Stichtag begründen, steht der Verkäufer ein, für Umstände, die die Kommanditistenhaftung ab dem Stichtag begründen, steht der Käufer ein. Die Parteien stellen sich insoweit wechselseitig frei.”
Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Nachdem das LG dem Zahlungsantrag stattgegeben hatte, hat das OLG die Klage insgesamt abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg, der Verkäufer muss also nicht zahlen.
Dabei hat der BGH die Auffassung des OLG bestätigt, dass ein vertraglicher Freistellungsanspruch nicht besteht. Es hat die oben wiedergegebene Klausel für unwirksam erachtet, weil die Bestimmung nicht klar und verständlich ist.
Das Transparenzgebot verpflichtet den Verwender von AGB, Rechte und Pflichten seiner Vertragspartner möglichst klar und durchschaubar darzustellen.
Dazu gehört nicht nur, dass die einzelne Regelung für sich genommen klar formuliert ist, vielmehr muss die Regelung auch im Kontext mit den übrigen Regelungen des Klauselwerks verständlich sein. Die Klausel muss außerdem die wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen für einen durchschnittlichen Vertragspartner so weit erkennen lassen, wie dies nach den Umständen gefordert werden kann. Abzustellen ist dabei auf die Erwartungen und Erkenntnismöglichkeiten eines typischen Vertragspartners bei Verträgen der geregelten Art.
Diesen Anforderungen wird die Freistellungsregelung in den allgemeinen Vertragsbedingungen der Käuferin nicht gerecht.
Die Pflichten, die durch die in den Vertragsbedingungen enthaltene interne Verteilung der Kommanditistenhaftung und die daran anknüpfende Freistellungsverpflichtung für den Verkäufer der Kommanditbeteiligung begründet werden, sind nach Ansicht des BGH weder hinreichend deutlich noch ausreichend klar und durchschaubar dargestellt, so dass auch die daraus folgenden wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen für einen durchschnittlichen Vertragspartner der Klägerin nicht genügend erkennbar und einschätzbar sind.
Rechtsfolge eines Verstoßes gegen das Transparenzgebot ist die Unwirksamkeit der betreffenden Bestimmung (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB).
In unserem Blog finden Sie weitere Beiträge zum Gesellschaftsrecht.